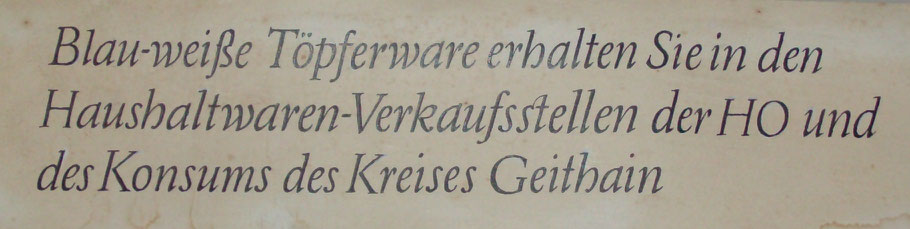Wissenswertes ausführlich
Bedeutung der Glasur und Fakten zur Bleiglasur
Um das irdene Geschirr gebrauchsfähig zu machen, kam Glasur zum Einsatz. Die Töpfer stellten diese selbst her (Bilder von Glasurmühlen am Ende des Textbeitrages). Jeder Töpfer hatte sein spezielles Glasurgeheimnis, die Zusammensetzung wurde streng gehütet und nur mündlich innerhalb der Familie bzw. an den Nachfolger weitergegeben. Es liegt in der Natur der Sache, dass mancher Meister durch plötzlichen Tod sein Geheimnis mit ins Grab nahm.
Die Glasur bestand vorwiegend aus (Siliziumdioxidhaltigem) Quarzsand, dem Grundstoff des Glases. Um die hohe Schmelztemperatur des Quarzsandes – etwa 1600°C – herabzusetzen und damit zu verhindern, dass der Scherben schmilzt und seine Form verliert, wurden der Glasur Flussmittel zugesetzt. Mit Blei konnte der Schmelzpunkt auf etwa 1000°C herabgesetzt werden. Würde man theoretisch bei 1600°C brennen – was in den Öfen sowieso nicht erreicht werden konnte – so würden die Teile schmelzen und der gesamte Brand einstürzen. Blei wurde bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts verwendet. Bleiglasuren geben dem Geschirr einen sanften Glanz, sind jedoch nicht ungefährlich. Bereits bei Wechselwirkungen mit schwachen Säuren wie Obst- oder Milchsäure, wird das in der Glasur gebundene Blei wieder freigesetzt und kann zu Bleivergiftungen führen. Beim Freisetzen des Blei´s bekommen die Speisen eine leicht süßliche Note, ein Effekt, der durchaus gewollt war und gern als positive Begleiterscheinung angesehen wurde. Indem man die Gefäße vor Gebrauch mit heißem Wasser ausspülte, versuchte man, die Bleikonzentration zu minimieren. Insbesondere die Töpfer unterlagen der Gefahr einer Bleivergiftung, da sie das Blei bei der Herstellung und Verarbeitung der Glasurmasse über die Haut aufnahmen und einatmeten.
Der Frohburger Apotheker Ferdinand Fischer erfand 1817 im Kohrener Land die bleifreie Glasur. Diese setzte sich jedoch nur sehr schwer durch, da die Töpferwaren nicht so schön glänzten wie mit bleihaltigen Glasur und sich schlecht verkauften.
Bei der Kohrener Keramik wird die Dichtheit ausschließlich durch die Glasur, bei älterer speziell durch die Bleiglasur erreicht. Anders beim sogenannten Steinzeug, wie es z. Bsp. in Waldenburg, Dippoldiswalde, Bürgel und im Rheinland gefertigt wurde und teilweise noch gefertigt wird. Bei der Herstellung von Steinzeug wird bei höheren Temperaturen gebrannt und die Dichtheit entsteht durch Sinterungsprozesse im Ton. Mit dem Nenkersdorfer Ton und den anderen Tonvorkommen im Leipziger Land war dies nicht möglich.
Die Gefäße wurden nicht immer vollständig glasiert (Siehe Krug Kohren 35). Es wurden verschiedene Qualitäten produziert die natürlich auch unterschiedliche Preise hatten. Aus Gesprächen mit einem alten Töpfer habe ich erfahren, dass die Glasur oftmals nur mit einem Pinsel aufgetragen wurde, denn Glasur war sehr teuer.
Model und Formen
Bräter, Back-, Melonen-, Fisch-, Krebsformen und vieles andere mehr wurden mit Hilfe von Modeln und Formen hergestellt. Diese wurden aus Gips oder Holz gefertigt. Es gab professionelle Modelhersteller / Modelstecher, die immer auf der Wanderschaft waren. Sie fragten bei den örtlichen Meistern an, ob etwas benötigt wird und blieben dann so lange, bis die Aufträge erledigt waren. Vor allem für das Bäcker- und Konditorenhandwerk sowie für die Pfefferkuchenherstellung ist dies überliefert. Deshalb gleichen sich viele Model im Lande. Sicherlich gab es auch den einen oder anderen talentierten Töpfer, der sich einige seiner Model und Formen selbst herstellte.
Man kann in Kohren-Sahlis im Töpfermuseum und in der Schauvitrine des Töpferhauses Arnold sehr schöne alte Model und Formen besichtigen.
Auswahl von Keramiken und den entsprechenden Modeln:
Fertigungsprozess - vom Tonabbau bis zum Verkauf auf dem Markt
Der Ton wurde mit Pferdefuhrwerken angeliefert und in den sogenannten „Tonbetten“, die sich gegenüber der Töpferwerkstatt befanden, gelagert. Sie lagen nahe an der Straße, um die Pferdefuder gut entladen zu können. Im 17. und 18. Jhdt. erfolgte der Tonabbau bei Nenkersdorf, im 19. Jhdt. vorwiegend in Niederpickenhain und in Greifenhain. Im 20. Jhdt. kamen Espenhain, Rathendorf, Frohnsdorf und Colditz hinzu. Die Tongruben wurden von den Töpfermeistern genossenschaftlich für mehrere Jahre gepachtet, die Töpfer selbst waren für den Abbau zuständig. Von der Innung wurde eine Person gegen Entlohnung dafür angestellt.
Der Kohrener Ton war nur von geringer Qualität und konnte nur zum Strecken mit besserem Ton oder zum Abdichten von Bauwerken benutzt werden. In den „Tonbetten“ vor den Töpfereien wirkten bis zu einem Jahr Regen, Frost und Sonne - der Ton wurde „gewittert“. Danach brachte der Töpfer mehrere steinharte Brocken in die Töpferstube, in deren Ecke sich eine Grube befand. Dort wurde der Ton mit Wasser übergossen, welches dann vollständig im Ton versickerte und ihn so aufweichte. Diesen Vorgang nennt man „Sumpfen“.
Den gesumpften Ton stampfte der Lehrling oder die Topfmagd mit nackten Füßen auf dem mit feinem Quarzsand bestreuten Fußboden durch, bis keine Klumpen mehr vorhanden waren. Dabei vermischte sich der Sand gleichmäßig mit dem Ton. Alle Steinchen mussten während der „Tontrete“ aussortiert werden. Der so gut vorbereitete Ton wurde in der hinteren Ecke der Töpferstube zu einem kegelförmigen Berg aufgeschichtet und feucht gehalten.
Von diesem Vorrat schnitten sich die Töpfer kleinere Mengen Ton mit der Sichel ab. Diese mussten vor dem Drehen auf der Walkbank (der Balken vor der Töpferscheibe) nochmals durchgeknetet und geschlagen werden, um Luftblasen zu entfernen.
Vor den Fenstern standen in der Töpferstube drei Töpferscheiben hintereinander. Vorn saß der Lehrling, in der Mitte der Geselle und hinten mit dem Rücken an der Wand der Meister – so hatte er alles im Blick. Beim Drehen verwendete der Töpfer als Hilfsmittel aus Pflaumenholz gefertigte Schienen in verschiedenen Größen und Formen. Das auf der Töpferscheibe geformte Gefäß wurde mit einem gezwirnten Draht abgelöst (Siehe Wissen kompakt) und anschließend wurden evtl. Schnepfen geformt.
Alle gedrehten Gefäßkörper wurden auf einem Brett abgestellt. War ein Brett voll, schob man es auf die in der Decke eingelassenen Trockendesen bis alle Stücke lederhart angetrocknet waren. Die Bretter voller Gefäße sind gut auf der nebenstehenden Aufnahme zu erkennen.
Danach wurden Henkel, Knäufe oder Ausgüsse angebracht (meistens die Arbeit des Meisters) und man stellte alles wieder zum weiteren Trocknen ab. Nach vollständiger Trocknung des Töpfergutes erfolgte die Bemalung. Die Gefäße wurden einst mit einem Lehmguss versehen, der aus hiesigem aufgelöstem Lehm bestand und durch ein Haarsieb getrieben wurde. Mit der Kelle oder dem Löffel entstand das Löffelmuster, durch eintauchen der Gefäße in den Asch das Latzmuster (Siehe Wissen kompakt und Krüge). Anschließend wurde nach einem nochmaligen Trocknungsprozess die Bleiglasur aufgetragen. Diese war meistens farblos.
Das Einstapeln der getrockneten Gefäße in den Ofen übernahm natürlich der Meister selbst, auch der gesamte Brennvorgang wurde von ihm überwacht. Das sogenannte „Einlegen“ der Gefäße in den Ofen erfordert viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung. Pro Brand passten 1500 bis 1700 Gefäße in den sogenannten "altdeutschen Langofen" oder auch "Kasseler Ofen Bürgeler Art" hinein.
Brennen war Sache des Meisters. Die Fläche, auf der im Ofen Gefäße gestapelt werden konnten, war ungefähr 3 m lang. Für einen Brennvorgang benötigte man ungefähr 3 Raummeter meterlange Holzscheide. Zuerst wurde Hartholz gefeuert (Eiche und Buche), danach wurde Nadelholz gefeuert. Ein Brand dauerte 15 bis 20 Stunden. Gebrannt wurde in der Regel alle 1,5 Wochen.
Der Brennofeneingang wurde mit Töpfen zugesetzt und mit Lehm verschmiert. Danach feuerte man den Ofen an, das Feuer wurde über 2-3 Feuerlöcher bedient. Die Befeuerung erfolgte wie schon beschrieben 15 bis 20 Stunden ohne Pause. Hatte der Ofen die notwendige Hitze erreicht und „der Fuchs guckte aus der Esse“, das heißt, es wurde ein Feuerschein aus dem Schornstein sichtbar, stellte man das Feuer allmählich wieder ein. Man verschloss alle Schürlöcher und ließ so das Feuer eingehen.
Der Ofen musste nun langsam erkalten, dann konnte die Ware entnommen werden. Ein plötzlicher Temperaturwechsel bei zu zeitigem Öffnen des Ofens würde zu Haar- und Brandrissen führen, die die Qualität der Erzeugnisse erheblich mindern würden.
Die Arbeitszeit in der Töpferwerkstatt ging von morgens 6 Uhr bis abends 7 Uhr. Mittags wurde eine Stunde Pause gemacht, Frühstück und Vesper jeweils eine halbe Stunde. Gearbeitet wurde von Dienstag bis Samstag. Samstagnachmittag wurde die Werkstatt gesäubert, am Sonntag war Kirchgang. Am Montag bestanden die Gesellen auf ihrem rechtlich zugesicherten blauen Montag, um den es aber immer wieder Streit gab. Schon 1636 hat der brandenburgische Kurfürst Georg Wilhelm per Erlass den blauen Montag in Brandenburg abgeschafft.
Alle Mitglieder der Töpferfamilie arbeiteten mit. Die Kinder mussten ihrem Vater z. Bsp. beim Einsetzen und Austragen des Ofens die Stücke zureichen bzw. abnehmen – das Setzen der Teile in den Ofen war ja Meistersache – und beim Ausfahren der gebrannten Stücke mussten sie diese mit einem Federwisch abputzen und die Flugasche beseitigen.
Unverheiratete Gesellen, Lehrlinge und Mägde wohnten im Haushalt des Meisters und wurden dort mit verpflegt. Mahlzeiten nahmen alle gemeinsam in der Töpferstube ein. Typisch für das Kohrener Töpferhandwerk ist die Kombination von Arbeits-, Wohn- und Essraum in der sogenannten Töpferstube.
In den alten Zeiten waren die meisten Töpfereien ihrer Größe und Anlage nach mit stattlichen Gütern vergleichbar. Eine Töpferei umfasste damals das Wohnhaus mit Werkstatt, ein Brennhaus, ein Ladehaus. Töpfer mit eigenen Fuhrwerken, die somit nicht auf Lohnfuhrleute angewiesen waren, besaßen natürlich auch große Ackerflächen, um das Futter für die Pferde und andere Nutztiere anbauen zu können.
Weiterhin gehörte zu jeder Töpferei ein Lageplatz für das Brennholz, ein sogenannter Scheidplan (für viele Raummeter Scheidholz). Gegenüber der Werkstatt befanden sich (wie schon beschrieben) die
Tonbetten, in denen der Ton gelagert wurde.
Die fertigen Erzeugnisse wurden in einem sogenannten „Ladehaus“ gelagert. In ihm wurden die Vorbereitungen für eine neue Fuhre über Land getroffen. Das gewissenhafte und sorgfältige Aufladen war wiederum eine Arbeit, die der Meister selbst durchführte. Jeder Topf wurde in Stroh oder Heu eingepackt, schichtweise verladen und jede Schicht erneut mit Stroh oder Heu abgeschlossen. An den Seiten und an der Rückwand des Wagens hingen zusätzlich Weidenkörbe und Topfgitter. Bei der Fahrt zum Markt sollten bei den Ortsdurchfahrten die Dorfbewohner die Artikel sehen, vielleicht kaufte ja der eine oder andere etwas. Zum Schluss wurde alles gut verzurrt.
Nur manchmal besaßen die Töpfer eigene Fuhrwerke. Meistens mussten sie Fuhrmänner mieten, die sie für die Fahrt zu entlohnen aber auch mit Speisen, Quartier und natürlich Branntwein zu versorgen
hatten. Hinzu kamen Brücken- und Straßenzölle und Standgebühren auf den Märkten. Nicht auf jedem Markt durfte man seine Ware feilbieten, alles war streng geregelt.
Den Töpferfrauen – die Ehefrauen der Meister – kommt besondere Bedeutung zu:
Sie allein waren für den Verkauf der fertigen Produkte zuständig. Sie schlugen sich mit den rüden Fuhrmännern auf oft wochenlangen Reisen herum. Sie brachten die Ware bis nach Leipzig, Dresden, Chemnitz, Zwickau, Aue, Schwarzenberg, Plauen, Jena, Erfurt, Naumburg, Merseburg und Halle. Etwa 40 Städte mit ihren Märkten sind Belegbar.
Völlig zu Recht hat Kurt Feuerriegel die Figur der Töpferfrau / Meistergattin oben auf den Töpferbrunnen in Kohren-Sahlis gestellt und so gewürdigt, nur sie machte die Ware zu Geld.
Die Stücke kosteten oftmals nur wenige Pfennige, trotzdem stellten diese für den Hausrat einen hohen Wert dar. Abplatzungen und Sprünge waren kein Grund, die Gegenstände wegzuschmeißen.
Sie wurden natürlich vererbt und ihr Wert wurde geachtet. Umherziehende sogenannte Rastelbinder - im Sachsenlande meistens Slowaken - flochten gesprungene Keramiken mit Draht ein. Diese Keramik bezeichnet man als eingestrickte oder eingerastelte Keramik.
Erwähnt werden muss auch noch folgendes:
Die Kohrener Töpfer waren gleichzeitig auch Ofensetzer. Schöne alte Ofenkacheln sind im Töpfermuseum Kohren-Sahlis, vor allem aber in der Hofmann’schen Sammlung und auf der Burg Gnandstein zu sehen. Die bürgerlichen und adligen Haushalte hatten ab dem 16. Jahrhundert eine Vorliebe für Kachelöfen mit schönen Bild- und Motivkacheln. Seit 1780 arbeitet jedoch kein Ofenkachler mehr in Kohren.
Vom Stolz Kohrener Töpferkunst spricht ein Töpferzeichen von 1824 am Hause der heutigen Töpferei Arnold. Es zeigt einen pfeifenrauchenden Meister an der Töpferscheibe neben dem sein Werk vollendenden Ofensetzer.